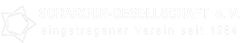Aeronauticum, Nordholz bei Cuxhaven

Die 1975 errichtete „Bootshalle“ des Deutschen Schiffahrtsmuseums machte Platz für einen Erweiterungsbau. Die Konstruktionen übernahm 1994 das Luftschiff- und Marinefliegermuseum „Aeronauticum“, flog sie nach Nordholz bei Cuxhaven (Wurster Nordseeküste) und stellte sie wieder auf. Sie sind dort seit 1997 als „Scharoun-Halle“ zu besichtigen.
Projektarchitekt Peter Fromlowitz.
2006 in ähnlicher Form erweitert (Architekt Herbert Butt).
Grundsteinlegung Erweiterung Neue Nationalgalerie. Oder M20. Oder „Museum der Moderne“. Oder „berlin modern“. Oder, oder…

Ein Kommentar von Dimitri Suchin.
Am 9. Februar, 4 Jahre nach dem Ersten Spatenstich, ist in Berlin der Grundstein gelegt worden für ein neues Museum. Wann und vor allem wie es eröffnet, ist ungewiß; die obige Namensaufzählung ist nicht abschließend. Vier Jahre, als wäre märkischer Sand plötzlich Alpengestein; doch die Ursache für den Verzug liegt woanders: das Haus ist durch und durch ein anderes geworden.
Am Anfang war der Bau eine Tomba mit kleinsten Alibi-Öffnungen, und auch sein Architekt an Arroganz kaum zu überbieten („Ihr werdet unser Haus lieben müssen„): selbst die abgehobene Nationalgalerie gestattet einem wenigstens den Einblick von Außen! Doch es folgte die Überbearbeitung, die Öffnung zum Scharoun-Platz, die Loslösung der Platane aus der Umfassung, die Medientore zur Staatsbibliothek hin (inzwischen wieder einkassiert). Die Wände wurden zum durchbrochenen Ziegel-Flechtwerk.
Nun sind auch sie passé, die sich dereinst so plump vor allen anderen stellende Urform duckt sich auf Renderings ins Baummeer des erweiterten Tiergartens und hinter eine dichte Baum-Doppelreihe. Die Wände sollen, den Verlautbarungen nach, aus Rezyklier-Ziegeln sein (auf Renderings sind da noch die handgefertigten dänischen Fabrikate zu sehen), Solarpaneele kommen aufs Dach — es gibt ja inzwischen Dachsteine mit eingelassenen Solarzellen (warum sind bei der Sanierung der Neuen Nationalgalerie keine entsprechende Anlagen auf ihr Dach gekommen?).
Im Inneren fiel die „Nabelschnur“ der Verbindung zur (alten/neuen) Nationalgalerie fort, ein wesentliches Kriterium beim Wettbewerb 2016, und führte unweigerlich zu jener Raumdoppelung, die man vermeiden wollte. Die tiefen Gründe sind nicht bekannt, die vielfach angeführten Leitungen in der Sigismundstraße werden es kaum gewesen sein: man ist mit der Gebäudesohle fast schon volle zwei Geschosse darunter! Der Bauplatz ist fixiert, die First mit den Simsen der Nationalgalerie und der Philharmonie auch, so wuchs das Haus nach unten. Kostspielig? — ja! Anders zu lösen auf einem anderen Bauplatz? — sicher! Doch auch in diesem Untertagebau steck(t)en viele Chancen: wird das Buddeln kritisiert, grabe erst recht tief!
Keiner wird sich damit besser auskennen als die Schweizer: ist denn jemals auch untersucht worden, zum Kammermusiksaal, zur Staatsbibliothek und zum Kupferstichkabinett zu graben? Gerade wenn man deren Bestände in den eigenen Wänden zu präsentieren plant? (fast wie im „Haus der Mitte“ — nur daß dieses nicht gebaut werden dürfte). Alle diese Institutionen haben tiefe Keller, ja sogar eine Tunnelverbindung Philharmonie-Piazzetta; unter Mies´ Nationalgalerie wäre sogar noch ein 2. Untergeschoß zu legen! Anzudenken wäre auch eine (unterirdische und offensichtliche) Verbindung zum Film des 20. Jahhunderts: dem Vernehmen nach will die Deutsche Kinemathek aus dem Sony-Center ausziehen — welcher Platz wäre da sinniger als das des vor der Philharmonie geplant gewesenen „Audio-visuellen Zentrums“, dem neuen Museum direkt gegenüber?.. Vielleicht ist es auch aus diesem Grunde, daß der Grundstein seine Liegestätte nach dem Ende der Ehrenrunde wieder verließ: eine Grundfeste war er nicht.
Da darf man auch in dieser späten Stunde einen eigenen Vorschlag wagen.
Im Entwurf war der Staatsbibliothek-Lesesaal eine Antwort auf die Nationalgalerie, ihre Einbindung in die Stadt; Sonnenschutzlamellen daran und Otto-Braun-Saal davor machen dies nicht mehr wahrnehmbar. Das Nationalgalerie-Plateau hat auf der anderen Straßenseite noch heute eine Entsprechung — nur den Terrassenrestaurant sucht man vergebens. Nun soll eine Straßenbahn-Endhaltestelle auf die Mittelinsel vor der Potsdamer Brücke, man plant und ängstigt sich zugleich. Verlegt die Halte zum entstehenden Mauerzug an der Potsdamer Straße! Dort, in einer Art Avalanche-Galerie lohnt sie sich gleich mehrfach:
- Die Gleisverschwenkung in Seitenlage beruhigt zwangsläufig den Verkehr und der sinnlose Bürgersteig am Museum verschwindet mit.
- Die offene Loggia vermittelt zwischen dem Lesesaal und der Nationalgalerie, belebt die Fassadenwand und verdeckt die Solarpaneele auf dem Dach.
- Die Chance einer Terrassenverknüpfung bleibt bewahrt, und auch die beliebte umrankte Würstchenbude könnte an ihren Platz zurückkehren.

2 Moholy 2
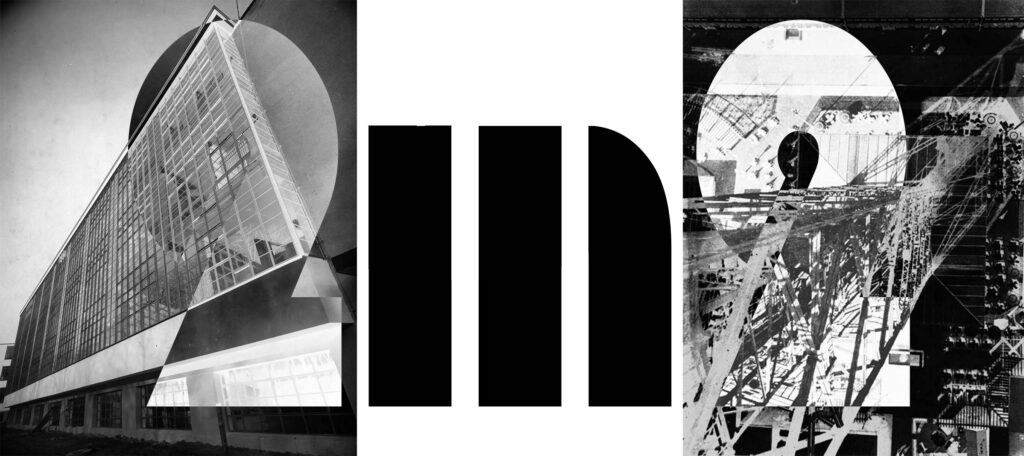
Ganze zwei Ausstellungen widmen sich in diesem Herbst den Künstlerpersönlichkeiten Lucia Moholy und Laszlo Moholy-Nagy. Den Anfang macht das Bröhan-Museum mit „Das Bild der Moderne„, ein Monat später folgt das „Magyar Modern“ in der Berlinischen Galerie. Es gibt Führungen und weitere Begleitveranstaltungen.
Was es leider nicht gibt, ist der Bezug zum Leben und Wirken der beiden Künstler in der Stadt. Genauer, zum Nichtandenken an sie auf den Straßen Berlins. Denn weder in der Fredericiastr. 27, noch in der Spichernstraße 20 finden sich Gedenktafeln oder andere Verweise.


Nicht daß wir nicht versucht hätten – aber ganze 50 € Spenden bezahlen keine einzige Tafel.
Hans Scharouns für das DSM

Zum Tag des offenen Denkmals 2020 stellt das Bremerhavener Deutsche Schiffahrtsmuseum eine Internet-Ausstellung zusammen und leuchtet die Geschichte seines Scharoun-Baus in Bild, Zeitstrahl und Podcast aus: Nutzererfahrungen seitens Museumsforscher und -Besucher, Sanierungsbelange der Denkmalpflege und Planer, sowie ideelle Hintergrunde kommen zusammen:
„Historische Ansichten und ausgewählte Fotobeiträge ergänzen die Übersicht zur Architektur des Gebäudes. Sie bieten Einblicke in die Geschichte des Scharoun-Baus, seine Entstehung und Nutzung. Luftaufnahmen, Innenansichten und Details ermöglichen den virtuellen Zugang zu einem Denkmal, das derzeit nicht besichtigt werden kann. Das historische Potenzial des Gebäudes wird sichtbar und schenkt Vorfreude auf eine Wiedereröffnung des Scharoun-Baus.“
Es sprechen: Olaf Mahnken, Landesamt für Denkmalpflege; Bernd Wiedenroth, Architekt; Dimitri Suchin, Scharoun-Gesellschaft; Ruth Schilling, Ausstellungs- und Forschungkoordinatorin; Sunhild Kleingärtner, Geschäftsführende Direktorin.
Wir danken Karolin Leitermann für die Möglichkeit, an diesem Projekt mitzuarbeiten.
Museum des 20. Jahrhunderts gestoppt?

BauNetz berichtet vom jähen Ende des Museums des 20. Jahrhunderts auf dem Kulturforum. Als Grund werden die wirtschaftlichen Unwägbarkeiten in Folge der Corona-Krise genannt. „Hinter vorgehaltener Hand ließen nicht nur Akteure der Kulturszene, sondern auch einschlägige Politikerinnen durchblicken, dass Argumentation und Zeitpunkt der Entscheidung vorgeschoben seien, um das Projekt ohne Gesichtsverlust stoppen zu können.“
Eine nachvollziehbare Meldung. Wenn nur die Erläuterung nicht da wäre.
Denn: die Baugrube soll ein Ententeich werden, ein „intellektuell niedrigschwellige“ Versöhnungsgeste in der Obhut der zu gründenden Stiftung unter der Führung des gewesenen Bauakademie-Hauptmanns Florian Pronold.
Lieber Gregor Harbusch! Danke für ein Paar schöne Minuten. Doch weniger (Text) wäre in diesem Fall wirklich mehr. Weil überzeugender.