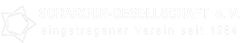Scharouns Leben
Bernhard Hans Henry Scharoun wurde am 20. September 1893 in Bremen geboren, als Kind von Bernhard Scharoun und dessen Gattin Friederike, geborene Sevecke. Des Vaters Wurzeln reichen ins böhmische Solnitz, wo noch heute Šarauns leben; die der Mutter nach Lüneburg und Oldenburg. Nebst einem Onkel Carl auf Wangerooge gibt es weitere in Siracuse, USA; von diesen Ästen stammen die heutigen Scharouns.
Hans wachst mit seinen Brüdern Carl (*1890) und Christian (*1899) in der aufstrebenden Hafenstadt Bremerhaven in der „Carlsburg“-Brauerei auf, wo sein Vater kaufmännischer Direktor ist. Er besucht 1900-1911 das städtische Gymnasium, seine Liebe zum Zeichnen und Entwerfen wird entdeckt und gefördert.
„Seinem Entwurf für ein neues Stadttheater von Bremerhafen gibt er [1909] die Baunummer 11 und das Motto „Anne-Marie“, dem Namen von Aenne, der Tochter [des Bauunternehmers] Georg Hoffmeyers.“ („Chronik zum Leben und Werk“, S.18)
Bereits an diesen frühen Kirchen, Theatern und Wohnhäusern stehen Sätze vermerkt wie „Ein selbständiger Architekt soll sich nicht von Sensationen, sondern von Reflexionen leiten lassen.„ (1910):
„Scharouns Gedanken zeugen von […] Bemühen, Gegensätzliches in Balance zu bringen“ und von „Beharrlichkeit, grundsätzliche Erkenntnisse wider aller Tagesmoden zu verteidigen.“ („Hans Scharoun — Außenseiter der Moderne“, S.7)
Sein Vater stirbt 1911, die Brüder fallen im 1. Weltkrieg, Aenne und Hans heiraten 1920.
Nach dem Abitur geht Hans Scharoun nach Berlin
und beginnt im April 1912 mit dem Architekturstudium an der Königlichen Technischen Hochschule in Charlottenburg. Bald lernt er Privatdozenten Paul Kruchen kennen, einen „mit der Jugend empfindenden Menschen“, arbeitet in Architekturbüros von Kruchen und von Ernst Schneckenberg, sowie als Maurerlehrling bei Hoffmeyer, wird für hochschul-intern für eine Volkslesehalle und ein „Theater der Stadt Wolfsburg“ ausgezeichnet. Die „theoretische Ausbildung an der Hochschule“ reicht ihn nicht.
1914 meldet sich Scharoun zum Kriegsdienst,
wird Anfang 1915 eingezogen und kommt über Zwischenstationen nach Cottbus-Merzdorf. Hier erprobt sein Lehrer Kruchen die Kriegsgefangenen-Ausbildung und ihr Einsatz im Bauwesen, feiert Erfolge und wird mit einer größeren Aufgabe betraut: das „System Kruchen“ soll Grundlage des Wiederaufbaus von Ostpreußen sein. Scharoun kommt mit nach Stallupönen, ab 1917 nach Insterburg, führt eigene (Notkirche Walterkehmen, Sprindt) und zahllose fremde Entwürfe aus — sie werden von der Hochschule nicht als Studienleistungen angerechnet. Nach Wettbewerbsgewinn in Prenzlau übernimmt Scharoun das Kruchen´sche Bauberatungsamt zum April 1919 als eigenes Büro: Architekt BDA DWB ohne Abschluß.
„Es war — nach dem 1. Weltkrieg — ein neuer Aufbruch. Die Frage nach der neuen Wirklichkeit, nach der neuen Gestalt des Gemeinsamen war gestellt. (…) Jeder von uns versuchte, sein Weltbild mitzuteilen.“
Von Bruno Taut eingeladen, sein „Aufruf zum Farbigen Bauen“ zu zeichnen, setzt Scharoun diesen umgehend um, in der „Bunten Reihe“ (1921-1924) zu Insterburg. Es folgen weitere Wohnhäuser und Anlagen; die Zeichnungen der „Gläsernen Kette“ finden sich in seinen Wettbewerben wieder (Volkshaus Gelsenkirchen und Hygienemuseum Dresden 1920). Im Hochhaus Friedrichstraße und Börsenhof Königsberg (1921), im Ulmer Münster (1924) zeigt sich die Wandlung vom Expressionistischen zum flächig-fließenden Bau.
In die selbstentworfene Insterburger Wohnanlage „Parkring“ (1923-1924) ziehen Scharouns auch ein, wie später in die Siemensstadt, ins „Romeo“ und in Charlottenburg-Nord. Eine weitere Eigenart bilden die Möbelausstattungen; einlassene Sofas für 7-8 Personen werden zu Scharouns Markenzeichen.
Anfang 1925 zieht Scharoun nach Breslau,
an die Akademie für Kunst und Gewerbe berufen und formuliert das Prinzip der Häuser als Leistungsorgane der darin ablaufenden Vorgänge. Als „Farbdezernent“ verantwortet er die Gestaltung ganzer Stadtteile und beginnt die Partnerschaft mit Adolf Rading, dem anderen Professor für Architektur; 1926 treten beide in Berlin dem „Ring“ bei. Da die auffällig-modernen Wohnkonzepte auf den DWB-Ausstellungen in Stuttgart-Weißenhof, Liegnitz (1927) und Breslau-Grüneiche (1929) keine Aufträge nach sich ziehen, streben die Architekten nach Berlin. Dort entstehen, teils noch aus der Breslauer Ferne, die Großsiedlung Siemensstadt (1929-1931, Weltkulturerbe) und die Appartmenthäuser (Kaiserdamm 1928-1929, Hohenzollerndamm 1929-1930).
Ganz ohne Folgen verblieben die Holz- und Stahlbau-Experimente nicht, wie auch die ideellen Enwürfe („Weite„): daraus entspringen das Haus Schminke und die Kunststoff-Serie (1946).
Von 1930 an bleibt Berlin-Siemensstadt Scharouns ständiger Wohnsitz,
benachbart und befreundet mit Adolf Rading, Oskar Schlemmer, Karl Böttcher, Lyonel und Julia Feininger, Sergius Ruegenberg, Ludwig Hirschfeld-Mack. Man plant und baut die Zweibrücker Str. und das Haus Schminke, bis Rading 1933 das Land fliehen muß, gefolgt von Schlemmer und Hirschfeld-Mack. Scharoun bleibt, perfektioniert die Grundstücksnutzung seiner Pläne, den Raumfluß darin und die Abschottung von der Straße — im Haus Mattern (1932-1934), Haus Baensch (1934-1935), Haus Hoffmeyer und Haus Bader-Bornschein/Pflaum (beide 1935), Haus Moll (1936-1938), Haus Mohrmann (1938-1939), Haus Möller (1939), Haus Endell (1940)…
Der Mietshausplanung für die halbstaatliche Gewobag in Berlin, die „Neue Heimat“ der DAF Sachsen und die Bremerhavener Wohnungsbaugesellschaft, an der die Scharouns einen Anteil halten, gibt ihm die Sicherheit, weiter zu träumen:
„Vom Ausbruch des Krieges bis zur Kapitulation entstanden Tag für Tag Zeichnungen, Aquarelle, Entwürfe. Sie entstanden aus Selbsterhaltungstrieb, und aus dem Zwange, sich mit der Frage der kommenden Gestalt auseinanderzusetzen.“
In der CIAM-Gruppe (1931-1944) geht es um die „funktionelle Stadt“, im Deutsch-chinesischen Werkbund um die „Stadt der reinen Erziehung“ (1940-1942), in der Deutschen Akademie für Wohnungswesen, um „Gemeinschaftseinrichtungen und Waschküchen“ nach dem Endsieg (1942-1943). Ab 1944 verdrängt alles die Fliegerschädenbeseitigung, prädestiniert Scharoun für seine Rolle im
Neuen Berlin.
Die Dezernenten und Amtsleiter um den Baustadtrat Scharoun planen 1945-1946 die Umgestaltung Berlins entsprechend seiner Landschaft und seiner neuen demokratischen Ordnung — sie wird abgeleht. Am Institut für Bauwesen der Deutschen Akademie der Wissenschaften geht die Arbeit 1947-1950 weiter, die Umsetzung der ersten Wohnzelle bleibt jedoch weit hinter den Erwartungen zurück. Es gelingt dagegen, an der neuen Technischen Universität ein Institut für Städtebau zu etablieren; aus einem Forschungsprojekt entwächst in Charlottenburg-Nord (1954-1961) eine bessere Umsetzung denselben ersten Planes. 1958 emeritiert und 1962 Ehrensenator, baut Scharoun noch den Städtebau-Flügel der Architekturfakultät (1962-1970).
1949 gründet Scharoun den Berliner Werkbund neu mit, 1955 die westberliner Akademie der Künste (im Osten gab es schon 1950 eine). Er bleibt ihr Präsident bis 1968 und Ehrenpräsident bis 1972.
Neue Entwurfswege
Bereits 1951 schlägt Scharoun mit der „Darmstädter Schule“ eine mitwachsende Klassengestalt vor — und lernt beim Vortrag von Martin Heidegger seine spätere zweite Frau kennen, Margit von Plato. Sie heiraten 1960, die Schulkonzepte werden erst in Lünen (1955-1962) und Marl (1960-1971, „Scharoun-Schule“) umgesetzt.
1952 gewinnt sein „aperspektivisches Theater“ den Wettbewerb in Kassel, bleibt aber unverwirklicht, wie auch sein Wiederaufbauplan für die Insel Helgoland (1952-1953). Gebaut werden erst die Stuttgarter Hochhäuser „Romeo“ und „Julia“ (1954-1959), gefolgt von „Salute“ (1959-1963) und anderen mehr. Zum Höhepunkt im Schaffen Scharouns und zur weltweit vielzitierten Planfigur „Musik im Mittelpunkt“ wird die Berliner Philharmonie (Großer Saal 1956-1963, Musikinstrumenten-Museum 1964-1971, Kammermusiksaal 1968-1987), jedoch ohne daß in jenen Zitaten „Demokratie als Bauherr“ weitergetragen wird.
1954 wird ihm ein Ehrendoktorat der TH Stuttgart angetragen, 1959 das Große Verdienstkreuz der Bundesrepublik überreicht. 1964 erhält er den Großen Preis des BDA, 1965 ein Ehrendoktorat der Universität Rom und den Auguste-Perret-Preis der Internationalen Arechitekten-Union. 1969 wird er ein Ehrenbürger Berlins.
Direkt beauftragt, plant und baut Scharoun ab 1964 die Botschaftsanlage der Bundesrepublik in Brasilia (bis 1971, Weltkulturerbe); im Wettbewerb wird sein Entwurf für den Neubau der Staatsbibliothek zu Berlin bestimmt. Die Fertigstellung 1978 erlebt er nicht mehr, das dazugehörige „Haus der Mitte“ auf dem Kulturforum wird nie gebaut. Posthum werden auch das Theater in Wolfsburg (1965-1973, „Scharoun-Theater“) und das Deutsche Schiffahrtsmuseum (1960-1975) eingeweiht.
Hans Scharoun stirbt am 25. November 1972 in Berlin (West). Er liegt auf dem Waldfriedhof in Zehlendorf.