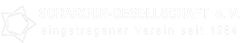Lease Hold und Lieschen hold

Zu den bekanntesten Begriffen britischer Immobilienspekulation der letzten Jahre gehörte das „Lease-Hold-Scam“: vorsätzliches und planmäßiges Bauen schlechter Häuser, die nach der Übergabe am lebendigen Leibe der Bewohner von deren Hausgeld saniert werden. Zu markantesten gebauten Beispielen davon zählen die überteuerten „Studentenwohnheime“, die, für echte Studenten absichtlich unerschwinglich gemacht, erst als Eigentumswohnungen und schließlich leider-leider als Ferienwohnungen auf den Markt kommen. Was am Ende auch mehr Geld bringt. London oder Cardiff sind voll davon; die britische Regierung verspricht, diese Vergeudung des knappen Baulandes und der öffentlichen Nor zu verbieten. So werden sich die Macher wohl auf die Umschau gegangen sein.
In Deutschland ist diese Masche nämlich bisher nicht aufgekommen, man hat nichteinmal einen passenden Namen dafür — wäre da nicht ein Fall aus Charlottenburg-Nord, von dem wir bereits mehrfach berichtet: „studentisches Wohnen… im unteren Preissegment“, für den Bauland mitten im nichtbebaubaren Denkmalbereich herausgezirkelt wurde (Abgeordnetenhaus 19.08.2021, Drucksache 18/28 396), eines das nach Baubeginn die Tarnnutzung abgelegt und nun bis zum doppelten Berlindurchnitt bepreiste Eigentumswohnungen stellt (8-10 000€/m2), bei ausgesprochen unbrauchbaren, bestenfalls als temporäre Unterkunft zu ertragenden Grundrissen. Die letzte Transformation steht noch bevor, doch wäre bereits die arglistige Täuschung ob des Bauzweckes nicht bereits ein Grund, von Amts wegen tätig zu werden? — Nein, die Verantwortlichen (Oliver Schuoffeneger/Grüne, Fabian Schmitz-Grethlein/SPD, Christoph Brzezinski/CDU) sehen nichts Besonderes im diesen Fahnenwechsel, reden sich heraus (Mindestabstände eingehalten, Höhe nicht überragend, an die Nachbarn angepaßt, Denkmalbereich bereits ausgefranst, Auslegung nicht vorgeschrieben, „vor meiner Amtszeit“) und weigern sich, die ihnen gegebenen Zwangsmittel anzulegen. Die Nachbarschaft verlangte nach einem Baustopp bis zur Aufklärung, argumentierte, widerlegte, zog sogar vor Gericht — ein alles andere als alltäglicher Vorgang — nur berichten wollte darüber bisher keiner. Man müßte fast an eine unheilige Verdeckungs-Allianz denken, und zieht man in Betracht, daß dies unmittelbar vor den eigenen Fenstern Scharouns und vor dem arg vernachlässigten Gedenkstein der Siedlung geschieht — an eine Allianz der Ignoranz!
Die Bürger wollten wissen:
- Gehört das neue Flurstück (weiterhin) zum Denkmalbereich oder wurde der Denkmalschutz genau für dieses Areal aufgehoben?
- Wer war Besitzer und somit Verkäufer des nunmehr geteilten Flurstücks der ehemaligen Vermittlungsstelle 38 — die finanzstarke Telekom?
- Hat die Telekom bzw. der Besitzer Nebenabsprachen getroffen? Wenn ja, welche?
- Welchen Einfluss hat der ehemalige zuständige Bezirksstadtrat Herr Schruoffeneger auf das Bauvorhaben und die Genehmigung genommen?
- In welchem Zeitraum bewegt sich die Genehmigungsphase von der ersten Anfrage bis zur Baugenehmigung?
- Wie war der Werdegang unter den zuständigen Ämtern, in welcher Reihenfolge wurden welche Genehmigungen erteilt?
- Gibt es aus dem Bezirksamt und den Denkmalämtern schriftlich niedergelegte Stellungnahmen zu dem Bauvorhaben und Genehmigungen oder wurden diese nur abgehakt?
Die Ämter schwiegen.
Verständlich, denn man kündigte in Vorab ein Skandal an, „wenn [es] sich herausstellen würde, daß hier Luxusswohnungen von vornherein geplant waren“ — und das waren sie. Man ging recht naiv und unvorbereitet in die ausgelegte Falle — doch ist es wirklich die Lösung, sich der Gespräche zu entziehen, keine Vorsorge gegen Nachahmer zu leisten, die Sache durchs Schnellerbauen „vom Tisch“ bekommen zu wollen? Jeder sieht den „hohen Bedarf an Wohnraum“, doch will die allgemein nützliche Lösung dieser Frage, nicht nur in Denkmalbereichen, kreativ und nicht etwa „kreativ verbucht“ sein. Man könnte sich auch der ursprünglich angedachten Komponenten Charlottenburg-Nords bedienen, die Häuserteppiche etwa, und sie weiterentwickeln.
Indes, wenn die Vermartkter den „kurzen Weg zum Flughafen“ anpreisen (für TXL hätte dies noch gestimmt), wird uns ein kurzer Blick gen London sicher auch gegönnt. Dort nämlich wurde vor Kurzem der Abriß der so errichteten Anlage „Mast Quay II“ beschlossen. Namensnähe zu „Spreetal Living“ ein Omen?
Schrank / Wander / Schaf(f)t
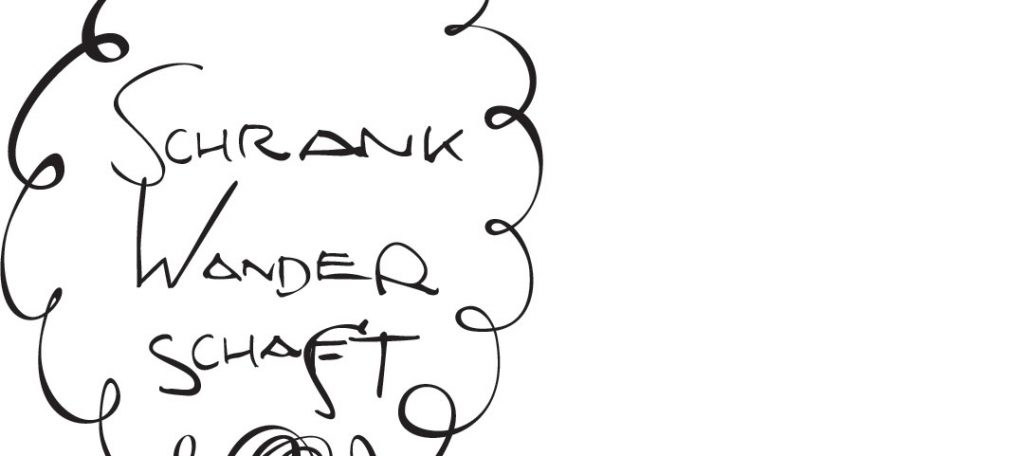
Im Jahre 1924 für Insterburg erbaut (WV 41), 1935 in Bremerhaven eingebaut (WV 135), ab 2018 wieder in Insterburg (WV 22): am 13. April 2017 zeichnet eine Sonderausstellung im Haus Schminke zu Löbau die Wanderwege eines Bücherschrankes von Hans Scharoun, „1924 für seine erste eigens entworfene Wohnung im ostpreußischen Insterburg“ erbaut:
Gesehen hat das historische Möbelstück Vieles und Viele. Nur ein Jahr konnten sich sich Hans und Aenne Scharoun des Stückes erfreuen und die (Bau-)Kulturschaffenden Insterburgs an ihm begrüßen, dann ging man getrennte Wege – um sich 10 Jahre später wiederzusehen: ab 1935 stand der Schrank im Bremerhavener Haus Hans Hoffmeyers, seines Schwagers, auch ein Werk Scharouns. Die Bomben von 1944 und die Besatzung von 1945 folgten – erst 1955 gab es ein erneutes Wiedersehen der Hoffmeyers, Scharouns und des Schrankes. Der letzte Besitzerwechsel war 1988; Anfang 2017 übergab Apotheker Gerd Welge den Schrank in die Obhut des Fördervereins Kamswyker Kreis und ebnete den Weg von Bremerhaven nach Löbau: ein Zwischenstopp vor heimatlichem Insterburg. Zwar steht das Ursprungshaus des Schrankes nicht mehr – dafür soll die „Bunte Reihe“, Scharouns erstes eigenes Bauwerk überhaupt, dem Schranke im „Offenen Zimmer“ die rechte Bühne sein. Die Lehrwerkstätten УМ/LW sollen mit seiner Restaurierung betraut werden.
Nebst Bildern aus den Beständen des Vereins, des Bildarchivs Ostpreußen und des Scharoun-Archivs, präsentiert die kleine Schau ein ungelöstes Rätsel des Schrankrückens, einen Schrank-Monolog für die Kleinen sowie eine Reihe von inspirierten Textilien zum Besten des Fördervereins „Kamswyker Kreis“.
(Aus der Pressemitteilung des Kamswyker Kreis e.V.).
Was wird hier wohl gemeint worden sein?
Haus Schminke wird gefördert
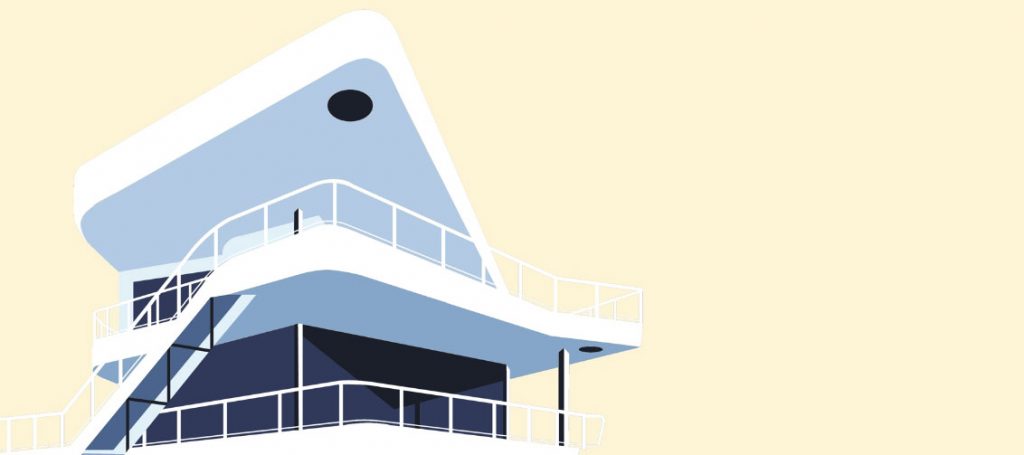
Die lange angeschobene Fassaden- und Dachsanierung des Hauses Schminke zu Löbau (WV 124) wird reell: wie „Der Tagesspiegel“ am 6. April berichtet, bekommt die Hausstiftung nebst bereits zugesagter Fördermitteln der Deutschen Stiftung Denkmalschutz auch noch Mittel der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien.
Die Bauarbeiten beginnen schon im August 2017.